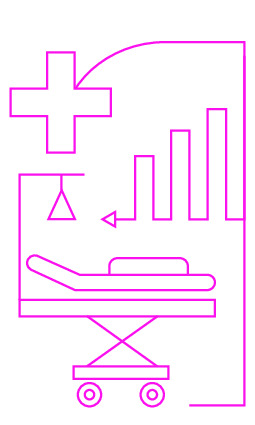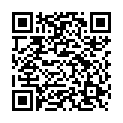|
|
| Modulbezeichnung (engl.):
Public Health II |
|
| Code: BAME18-09 |
|
|
6S (6 Semesterwochenstunden, kumuliert) |
|
7 |
| Studiensemester: 3 |
| Dauer: 2 Semester |
| Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Studienleistungen (lt. Studienordnung/ASPO-Anlage):
Schriftliche Seminararbeit |
Prüfungsart:
Prüfungsleistung: Klausur
[letzte Änderung 27.07.2017]
|
BAME18-09 (P311-0065, P311-0066) Management und Expertise im Pflege- und Gesundheitswesen, Bachelor, ASPO 01.10.2018
, 3. Semester, Pflichtfach
|
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 90 Veranstaltungsstunden (= 67.5 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 7 Creditpoints 210 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 142.5 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
BAME18-03 Public Health I
BAME18-05 Wissenschaftliches Arbeiten I
[letzte Änderung 22.08.2017]
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
|
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Iris Burkholder |
Dozent/innen:
Prof. Dr. Iris Burkholder
Prof. Dr. Martha Meyer
[letzte Änderung 22.08.2017]
|
Lernziele:
Epidemiologie:
Die Studierenden verstehen wesentliche epidemiologische Maßzahlen zur Messung von Krankheitshäufigkeiten und können diese berechnen. Sie lernen verschiedene Designs epidemiologischer Studien und deren spezifische Risikoschätzer kennen. Die Studierenden sind in der Lage, die geeigneten Schätzer und ihre Konfidenzintervalle zu berechnen und zu beurteilen. Die Studierenden setzen sich mit der Beurteilung syste-matischer und zufälliger Fehlerquellen in epidemiologischen Studien auseinander und befassen sich mit der Problematik der Kausalitätsbe-wertung. Die Studierenden sind in der Lage die Verteilungen von Daten anhand wesentlicher Parameter zu beschreiben und grafisch darzustel-len. Sie machen sich vertraut mit räumlichem und zeitlichem Monitoring im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung und kennen epidemiolo-gische Basisdaten wichtiger Krankheiten (z.B. Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen).
Übergänge im Lebensverlauf: sozial- und gesundheitswis-senschaftliche Perspektiven:
Das Seminar untersucht aus einer sozial- und gesundheitswissenschaft-lichen Perspektive die Statuspassagen ausgewählter gesellschaftlicher Gruppen - z.B. Kinder, Jugendliche, Ältere, Migrantinnen, Alleinerzie-hende usw. - in ihren jeweiligen biografischen Lebenskontexten und inwieweit diese zur Entstehung von Problemen und Krisen und zur Vul-nerabilität bestimmter sozialer Gruppen beitragen. Theoretische Ausei-nandersetzung mit Konzepten zu Übergängen im Lebenslauf. Reflexion der sozialen Prozesse eines in permanentem Wandel befindlichen Le-benslaufs. Recherche, Bearbeitung, kritische Diskussion der beeinflus-senden und gestaltenden Determinanten für unterschiedliche Belas-tungssituationen. Diskussion von Lösungsansätzen und Interventions-möglichkeiten, die biopsychosoziale Anpassungs- und Kompensations-prozesse begleiten und Unterstützung beim Übergang von einer Passa-ge in die andere anbieten.
[letzte Änderung 27.07.2017]
|
Inhalt:
Epidemiologie:
1. Grundlegende epidemiologische Maßzahlen
2. Deskriptive, analytische und experimentelle Studiendesigns
3. Risikoschätzer (Odds Ratio; Relatives Risiko)
4. Beschreibung und grafische Darstellung von Daten (Lagemaße, Maße der Variabilität)
5. Standardfehler und Konfidenzintervalle
6. Kausalitätskriterien
7. Zufällige und systematische Fehler
8. Gütekriterien diagnostischer Tests
9. Screeningverfahren
10. Gesundheitsberichterstattung
Übergänge im Lebensverlauf: sozial- und gesundheitswis-senschaftliche Perspektiven:
1. Theoretische Konzepte zur Transition und Statuspassage im Lebenslauf
• Ökopsychologie, Stresskonzepte, Lebensspannenansatz
2. Ungleichheit und gesundheitliche Ressourcen
• Bedeutung sozialer Netzwerke/ soziale Unterstützung; soziales Kapital,
• Selbstwirksamkeitserwartungen)
3. Ungleichheit und Gesundheitsverhalten
• Ungleichheiten in Morbidität und Mortalität
4. Gesundheitliche Bedeutung spezifischer sozialer Lagen
• Kinder/Jugendliche, Geschlecht, Migration, Ältere, Alleinerzie-hende, Arbeitslosigkeit)
5. Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit
[letzte Änderung 27.07.2017]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Print- und elektronische Medien, Folien
[letzte Änderung 27.07.2017]
|
Literatur:
Epidemiologie:
• Bardehle D, Annuß R (2012). Gesundheitsberichterstattung. In: K. Hurrelmann K, Razum O (Hg) Handbuch Gesundheitswissenschaften. Weinheim, Basel: Juventa, S. 403-440
• Bonita R, Beaglehole R, Kjellström, T (2013). Einführung in die Epidemiologie. 3.korr. Aufl. Bern: Huber
• Kreienbrock L, Schach S (2012). Epidemiologische Methoden. 5. Aufl. Heidelberg: Springer Spektrum
• Razum O, Breckenkamp J, Brzoska P (2011). Epidemiologie für Dummies. Weinheim: Wiley
• Statistisches Bundesamt (jeweils aktuell). Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Online verfügbar unter: http://www.gbe-bund.de/ (Aufruf 23.11.2015)
Übergänge im Lebensverlauf: sozial- und gesundheitswissenschaftliche Perspektiven:
• Bauer U, Bittlingmayer U, Richter M (Hg) (2009). Health Inequalities: Determinanten und Mechanismen gesundheitlicher Ungleichheit. Wiesbaden: VS-Verlag
• Filipp SH (Hg). (1990). Kritische Lebensereignisse. Psychologie- München: Verlags Union
• Geißler R (2008). Die Sozialstruktur Deutschlands. 4. Aufl. Wiesbaden: VS
• Helmert U, Bammann K, Voges W, Müller R (Hg) (2000). Zum Stand der Forschung: Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Weinheim und München: Beltz Juventa
• Hodek JM, Ruhe A, Greiner W (2009). Gesundheitsbezogene Lebensqualität bei Multimorbidität im Alter. Bundesgesundheitsblatt 2009 (52)
• Lampert T, Ziese T (2006). Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit. Expertise des Robert Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin: Robert Koch-Institut
• Mielck A (2005). Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Einführung in die aktuelle Diskussion. Bern: Hans Huber
• Richter M, Hurrelmann K (Hg) (2009). Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen, Probleme Perspektiven. 2. Aufl. Wiesbaden: VS
• Ruppe G (2001). Active Ageing and prevention in the Context of Long-Term Care. Policy Brief July 2001. European Centre For Social Welfare Policy and Research, Vienna
• Siegrist J (2005). Medizinische Soziologie. München: Urban & Fischer
Weitergehende und aktuelle Literatur wird jeweils in den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.
[letzte Änderung 27.07.2017]
|