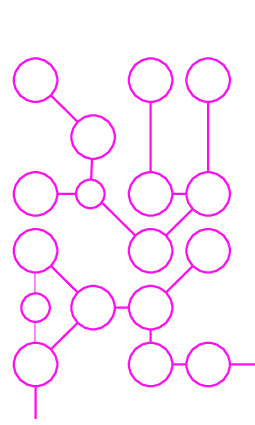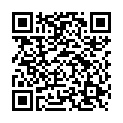|
|
| Modulbezeichnung (engl.):
Selected Fields of Work and Practices |
|
| Code: BSP-23 |
|
|
4S (4 Semesterwochenstunden) |
|
7 |
| Studiensemester: 6 |
| Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Studienleistungen (lt. Studienordnung/ASPO-Anlage):
Prüfungsregelungen zu Modul BSP-23:
In diesem Modul ist eine nicht benotete Modularbeit vorgesehen, um die 7 ECTS zu erwerben.
Die Modularbeit soll insgesamt einen Umfang von 18 – 25 Seiten haben.
Die Modularbeit soll sich aus zwei Teilen zusammensetzen, wobei sich Teil 1 auf BSP-23.1 und Teil 2 auf BSP-23.2 beziehen muss.
Die Teile sind kenntlich zu machen und jeder Teil muss den Mindestanforderungen entsprechen, um als bestanden zu gelten.
Sollte ein Teil nicht vollständig oder in der Qualität nicht ausreichend entsprechen, so gilt die Prüfungsleistung insgesamt als nicht bestanden. Die betreffenden Studierenden müssen dann den entsprechenden Teil überarbeiten und die gesamte Modularbeit noch einmal abgeben.
Die Note kann erst verbucht werden, wenn beide Teile eingereicht wurden. |
Prüfungsart:
BSP-23.1/.2: Modularbeit (MA) (nb)
[letzte Änderung 02.08.2017]
|
BSP-23 (P322-0003) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2017
, 6. Semester, Pflichtfach
BSP-23 (P322-0003) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2019
, 6. Semester, Pflichtfach
|
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 7 Creditpoints 210 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 165 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
|
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Mario Schreiner |
Dozent/innen: Prof. Dr. Mario Schreiner
[letzte Änderung 26.08.2019]
|
Lernziele:
Durch die erfolgreiche Beendigung des Moduls können die Studierenden
- ausgewählte Arbeits- und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit oder PdK sowie deren Arbeitskonzepte anwenden,
- Situations-, Ressourcen – und Problemanalysen erstellen und professionelle Vorgehensweisen mit dem Arbeits- und Handlungsfeld verknüpfen,
- konzeptionelle Überlegungen für Arbeits- und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit und Pdk ausbilden,
- den rechtlichen Rahmen in Bezug zum ausgewählten Arbeitsfeld ableiten,
- Methoden und Konzepte für das ausgewählte Arbeitsfeld handhaben.
Die Studierenden sollen in der Lage sein
- ausgewählte theoretische und empirische Fragestellungen Sozialer Arbeit zu überdenken und mit den Herausforderungen einer Migrationsgesellschaft in Bezug zu setzen.
[letzte Änderung 19.09.2017]
|
Inhalt:
BSP-23.1 Seminar zu ausgewählten Arbeits- und Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und PdK
Aufbauend auf das Modul 17.1 und die Erfahrungen im Praxissemester werden weitere vertiefende Einblicke in ausgewählte Arbeits- und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit oder Pädagogik der Kindheit exemplarisch erarbeitet. Die Studierenden vertiefen exemplarisch an einem ausgewählten Arbeitsfeld die konzeptionelle Ausgestaltung des Arbeitsfelds, den rechtlichen Rahmen und die entsprechenden didaktischen und methodischen Konzepte. Die Studierenden beschäftigen sich vertieft mit den jeweiligen Lebens- und Problemlagen der jeweiligen Adressatengruppe des ausgewählten Arbeitsfelds. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die das Arbeitsfeld prägen (z.B. Recht, Politik etc.) werden analytisch herangezogen. Die Rolle und Funktion der Fachkräfte des Arbeitsfeldes werden reflektiert und in konzeptionelle Überlegungen eingebunden.
BSP-23.2 Seminar zu ausgewählten theoretischen und empirischen Fragestellungen II
Die Inhalte ergeben sich durch die Auswahl ausgewählter theoretischer und empirischer Fragestellungen, beispielsweise zu Querschnittsthemen wie Migration, Interkulturalität, Integration: Anforderungen an (sozial-)pädagogisches Handeln und Organisationen der Sozialen Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Das Seminar befasst sich mit Fragestellungen, die sich im Zusammenhang der Einwanderungsgesellschaft in sozialwissenschaftlicher und sozialpädagogischer Perspektive stellen. Die theoretischen Grundlagen zur Analyse der ‚Migrationstatsache‘ werden erörtert, welche eng mit Interkulturalität und Fragen der Integration bzw. Inklusion verknüpft ist. Neuere Theoriedebatten, Konzepte und empirische Studien werden eingeführt und sind Gegenstand der gemeinsamen Beratungen. Vor dem Hintergrund des Wissensbestandes der sozialwissenschaftlichen Migrations- und Integrationsforschung sind insbesondere die Herausforderungen an (sozial-) pädagogisches Handeln in der Migrationsgesellschaft von Interesse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-23.1-1 + Frühe Hilfen und Frühförderung Sandra Hahn
BSP-23.2-1 Kinderschutz Petra Ludt-Vogelgesang
BSP-23.1-1
Pädagogische Frühförderung stellt ein zentrales Handlungsfeld der Pädagogik der Kindheit und der Sozialen Arbeit dar. Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter, die von Behinderung bedroht sind oder bei welchen bereits eine Behinderung diagnostiziert wurde sowie deren Familien stehen im Fokus einer pädagogischen Intervention der Frühförderung. Deren Logik und Ausgestaltung stellt ein Teil dieser Lehrveranstaltung dar. In der Folge wer-den Diagnostikverfahren dargestellt, welche Kinder zu Beginn einer Maßnahme durchlaufen, sowie die nachfolgende Erstellung eines Förder- und Behandlungsplans, um die Verbindung zwischen Theorie und Praxis zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden fallorientiert und praxisnah einzelne Zeiteinheiten dargestellt sowie aufgezeigt, wie spielerische Maßnah-men für z.B. entwicklungsverzögerte und/oder Kinder in bio-psycho-sozialen Krisen aussehen können. Die Bereitschaft der Studierenden zur Perspektivübernahme und konkreten Umset-zung verschiedener Übungen (z.B. Schulung der Feinmotorik, autogenes Training für Kinder, etc.) wird vorausgesetzt.
BSP-23.2.1
In diesem Seminar werden Wissen, Handlungskompetenzen und Praxistransfer zum Thema Kinderschutz erarbeitet, vermittelt und dabei reflektiert. Die Altersgruppe der Kinder von 0 – 10 Jahre steht hierbei besonders im Mittelpunkt. Geplant ist auch, zu bestimmten Themen Netzwerkpartner*innen aus Medizin, Justiz und Jugendhilfe einzuladen.
Die Veranstaltung ist (mit Auftakt- und Abschlusstermin) in folgende 5 Themenschwerpunkte unterteilt:
1.Formen der Gewalt gegen Kinder, Häufigkeiten und Folgen
2.Rechtliches und das Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung: Erkennen – Deuten – Handeln
3.Handlungskonzepte im Kinderschutz – Prävention / Intervention
4.Handlungskontexte bei Kindeswohlgefährdung (Bildung, Jugendhilfe, Medizin, Justiz)
5.Gewaltschutzkonzepte und gesellschaftliche Aufarbeitung
Die schriftliche Prüfungsleistung besteht aus der Arbeit zu einem Auftrag aus (wahlweise) einem der 5 Themenschwerpunkte. Unterlagen hierzu sind eingestellt. „Gewalt gegen Kinder“ – die Konfrontation damit führt oftmals zu Polarisierungen. So wird auch Sensibilisierung und emotionales Lernen im Sinne von „Ambivalenzmanagement“ und „Beziehungsorientierung“ ein Querschnittthema des Seminars sein.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-23.1-2 + Grenzüberschreitender Kinderschutz Lisa Homberg
BSP-23.2-2 Umsetzung der Kinderrechte Lisa Homberg
In BSP-23.1-2 steht der grenzüberschreitende Kinderschutz innerhalb der Großregion im Mittelpunkt. Nicht nur Erwachsene überqueren täglich die Ländergrenzen der Großregion – etwa aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit –, sondern auch Kinder und Jugendliche, bei-spielsweise im Rahmen von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. Daher ist es nahelie-gend, die unterschiedlichen Kinderschutzsysteme der Großregion sowie bestehende Her-ausforderungen und mögliche Fallstricke genauer zu betrachten. Grundsätzlich zeigt sich, dass der Kinderschutz in verschiedenen Gesetzestexten erwähnt wird, jedoch keiner ein-heitlichen Definition unterliegt. Vielmehr entwickelt sich die Fachdebatte hin zu einem erweiterten Begriffsverständnis.
Während eine enge Definition des Kinderschutzes vor allem das staatliche Eingriffsrecht bei unmittelbarer Gefährdung von Kindern und Jugendlichen betont, ermöglicht eine wei-ter gefasste Perspektive eine differenziertere Betrachtung. Sie integriert zentrale Prinzi-pien der UN-Kinderrechtskonvention, die über den reinen Schutzgedanken hinausgehen. Besonders die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen rückt dabei in den Fokus, wodurch sich die Aufgabenbereiche und Ziele des Kinderschutzes erweitern. Um die Kin-derrechte gemäß UN-Kinderrechtskonvention und deren grenzüberschreitende Umset-zung mit dem Fokus auf Partizipation wird es in BSP-23.2-2 gehen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-23.1-3 + Seminar Justizbezogene Kriminologie und Soziale Arbeit Marc-Alexander Seel
BSP-23.2-3 Seminar Theorien der Devianz Steinkamp, Ralf
Beschreibung der Veranstaltung BSP-23.1-3 Justizbezogene Kriminologie und Sozia-le Arbeit:
Die Lehrveranstaltung gliedert sich im Wesentlichen in die nachfolgend beschriebenen vier Themenkomplexe:
a) Gesellschaftliche Strafbedürfnisse und justizielle Sanktionierungspraxis
Zum Seminareinstieg wird die auf dem deutschen Strafrecht basierende Sanktio-nierungspraxis einer Auswahl von (empirisch belegten) gesellschaftlichen Straf-vorstellungen gegenübergestellt. Dabei wird aufgezeigt, unter welchen Aspekten Differenzen oder Übereinstimmungen feststellbar sind und welche Gesellschafts-gruppen besondere Strafbedürfnisse offenbaren.
Zudem soll beleuchtet werden, inwieweit subjektive Einflussfaktoren wie bspw. Kriminalitätsfurcht und/oder Viktimisierung aber auch eigene Delinquenz die in-dividuellen Kriminalitätswahrnehmungen und Sanktionseinstellungen beeinflussen können.
b) Justizielle Sozialarbeit als Instrument der Resozialisierung, Sozialen Kontrolle und Kriminalprävention
Unter Bezugnahme auf anonymisierte (Fall-)Beispiele aus der Berufspraxis der staatlichen stationären Sozialarbeit mit Straffälligen (v.a. in Jugendarrest- und Justizvollzugsanstalten sowie Forensischen Kliniken) und der ambulanten Straffäl-ligenhilfe (v.a. Bewährungs- / Gerichts- / Haftentscheidungshilfe und Führungs-aufsicht) erfolgt eine möglichst umfassende Darstellung der facettenreichen Handlungsfelder der Sozialen Dienste der Justiz.
c) Sonstige Reaktionsformen (wohlfahrts-)staatlicher und privater Institutionen auf Devianz und Delinquenz
Nach der Skizzierung bestimmter Dienstleistungsangebote von beispielhaft aus-gewählten Kooperationspartnern der Strafjustiz folgt eine kritische Auseinander-setzung mit den (zunehmend straforientierten) strukturellen Vorgaben beim Um-gang mit Devianz in ursprünglich auf wohlfahrtsstaatliche Unterstützungsleistun-gen ausgerichteten Institutionen. Hierbei werden insbesondere auch die mögli-chen Konsequenzen einer subsidiären Abgabe staatlicher Handlungsfelder an ge-meinnützige private Träger und/oder profitorientierte (Sicherheits-)Unternehmen in Hinblick auf die Forcierung einer Kriminalitätsprävention oder -Produktion dis-kutiert.
d) Restorative Justice und deren Anwendungsbereiche
Die Veranschaulichung justizgebundener und –ungebundener Reaktionsmöglich-keiten auf Delinquenz bzw. Devianz, die sich als Ergänzung oder Alternative zur bloßen Bestrafung der Normabweichler bewährt haben, stehen im Fokus des ab-schließenden Themenblocks. Die Seminarteilnehmer*innen setzten sich zunächst mit dem Konzept des „Täter-Opfer-Ausgleichs“ als konkrete Form der Diversion mit dem Hauptziel der Schadenswiedergutmachung auseinander und lernen dann unterschiedliche Varianten einer „Restorative Justice“ zwecks „(Wieder-) Herstel-lung“ des „Sozialen Friedens“ kennen.
BSP-23.2-3: Theorien der Devianz
Im Seminar „Theorien der Devianz“ geht es um die Klärung des Begriffs der sozialen Abweichung, sowie um die Reflexion der diesbezüglichen Vorstellungen für die Belange Sozialer Arbeit. Der Begriff wird anhand einer kritischen, theorieimmanenten Auseinan-dersetzung mit den „klassischen Ansätzen“ von Kriminologie und Strafrechtssoziologie – die einer uneingestandener Maßen reproduzierten „Ideologie der sozialen Verteidigung“ (Baratta) folgen – rekonstruiert: Diskutiert werden u.a. biologistische, psychologische / psychoanalytische, soziologische und „multifaktorielle“ Ansätze. Thesen und Theorien, die in diesem Zusammenhang behandelt werden, befassen sich u.a. mit folgenden Vor-stellungen: „Der geborene Verbrecher“, „Die Normalität (und Notwendigkeit (sic!)) von Abweichung“ (Durkheim), das Verhältnis von „Abweichung und Triebstruktur“ (Psycho-analyse), die Theorie der „Subkultur“ und des „differentielles Lernen“, die Analyse von „Techniken der Neutralisierung“, und schließlich dem „labeling approach“ (Becker, Sack).
Die zentrale Leitlinie unserer Reflexion der vielfältigen Ansätze zur Erklärung von Devi-anz ergibt sich aus den Überzeugungen und Grundüberlegungen einer „Kritischen Krimi-nologie“, welche abschließend diskutiert werden. Ausgangspunkt der theoriegeschichtli-chen Rekonstruktion der „Devianz“ wird der, innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums (während des Zeitalters der Aufklärung) erfolgte Wandel der Form staatlichen Strafens sein. In diese historische Phase fällt der Beginn der wissenschaftlichen Ausei-nandersetzung mit den Gründen bzw. den Ursachen für abweichendes Verhalten. Im Ver-lauf des Seminars werden sowohl sozialphilosophische und gesellschaftstheoretische, als auch erkenntnistheoretische bzw. methodologische Überlegungen einbezogen – so wer-den beispielsweise die Diskussion um die Entwicklung einer „Theorie“ (Popper) oder das Konzept der wissenschaftlichen „Paradigmen“ (Kuhn) zu erörtern sein. Auch stellt sich die Frage, was man mit Hilfe einer Theorie überhaupt auszusagen vermag, und was nicht („Reichweite“). Daneben haben aber auch einige grundlegende Fragestellungen und Überzeugungen der Kriminalwissenschaften ihren Platz in diesem Seminar.
Das Seminar stellt eine theoretisch fundierende Ergänzung zu dem Seminar von Marc-Alexander Seel (BSP-23.1-3) dar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-23.1-4 + Seminar Pädagogik differenzsensibel Sigrid Selzer
BSP-23.2-4 Seminar Kindheitsforschung Sigrid Selzer
BSP-23.1-4: Pädagogik differenzsensibel
Lebenswelten von Kindern und Familien sind vielfältig. Dies impliziert, dass jedes Kind in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und Schulen individuelle Bedürfnisse hat und mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen ausgestattet ist. Differenz wird in den Erziehungswissenschaften ebenso mit den Begriffen Diversity, Heterogenität oder auch Vielfalt benannt. In fachlichen und politischen Diskursen ste-hen der Zusammenhang von Diversität, ungleichen Chancen im Bildungssystem (vgl. Diehm et al. 2017) und Diskriminierung im Fokus, woraus hohe Anforderungen an päda-gogisches Handeln abgeleitet werden. Pädagogische Einrichtungen sollen kompensato-risch wirken und Diskriminierung verhindern.
Differenzsensibilität bedeutet in der Praxis bewusst und sensibel damit umzugehen, wann ein Unterschied mit dem Verweis auf ein bestimmtes Merkmal wie Alter, Ge-schlecht, Migration, Behinderung etc., gemacht wird und wann gerade nicht. Es geht darum zu reflektieren, welche Möglichkeiten Kindern durch eine Kategorisierung eröff-net bzw. verschlossen werden. Gleichzeitig gilt es, gesellschaftliche Bedingungen und pädagogische Anforderungen im Umgang mit Differenz zu berücksichtigen und kritisch zu reflektieren (vgl. Lamp 2010). Dies zielt darauf ab Kindern Ressourcen für eine indivi-duelle Lebensgestaltung zu eröffnen und sie zu stärken. Dabei bilden Kinderrechte, wie sie in der „UN-Kinderrechtskonvention“ verankert sind und ethische Perspektiven Be-zugspunkte (vgl. Prengel 2019).
Im Rahmen des Seminars werden verschiedene merkmalsübergreifende Ansätze, Kon-zepte und Methoden vorgestellt und anhand konkreter Fallbeispiele diskutiert. Einge-bettet wird dies in theoretische Überlegungen und ethische Reflexionen.
BSP-23.2-4: Sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung, Methoden und Studien
Die sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung ist in besonderer Weise den Perspekti-ven von Kindern verpflichtet und interessiert sich für ihre Alltagserfahrungen, die Bedin-gungen unter denen sie leben und ihre Sozialbeziehungen (Heinzel 2012). Sie geht von zwei Paradigmen aus, die konkrete Studien bestimmen: das Kind als Akteur sowie die generationale Ordnung.
Das Seminar widmet sich Forschung, die Kindheit in Zusammenhang mit Diversität re-flektiert und die Sicht von Kindern auf Differenz spiegelt. Spezifische Methoden der Kindheitsforschung werden beleuchtet und in ihren Möglichkeiten und Begrenzungen diskutiert. Ein Fokus liegt dabei auf ethischen Fragestellungen. Ausgewählte Studien werden exemplarisch vertiefend erörtert.
[letzte Änderung 01.03.2025]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
- Information (Input) durch die Dozierenden
- Praxiserkundungen in Gruppenarbeit mit Präsentation der Ergebnisse im Plenum
- Angeleitete Exkursionen in das jeweilige Arbeitsfeld
- Literaturstudium (Einzelarbeit)
- Seminaristische Übungen
- Erprobung ausgewählter handlungsmethodischer Ansätze, z.B. durch Plan- oder Rollenspiele
- Gastvorträge aus der Profession
- Selbststudium: Nachbereitung des Seminars und Vertiefung anhand ergänzender Unterlagen
- Kurzpräsentationen zu einer ausgewählten theoretischen und empirischen Fragestellung
[letzte Änderung 04.11.2017]
|
Literatur:
Wird dem jeweiligen Arbeits- und Handlungsfeld entsprechend ausgewählt.
[letzte Änderung 19.09.2017]
|