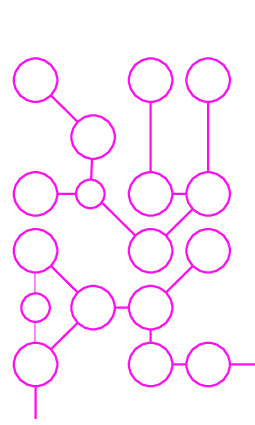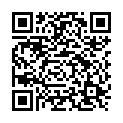|
|
| Modulbezeichnung (engl.):
Didactic Approaches in Childhood Education and Methodologies of Social Work |
|
| Code: BSP-16 |
|
|
5S (5 Semesterwochenstunden) |
|
6 |
| Studiensemester: 4 |
| Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
BSP-16.1 Modularbeit Teil a (70 Prozent) (MA) (bn)
BSP-16.2 Modularbeit Teil b (30 Prozent) (MA) (bn)
[letzte Änderung 26.08.2019]
|
BSP-16 (P322-0008, P322-0009, P322-0074) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2019
, 4. Semester, Pflichtfach
|
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 123.75 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
|
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Iris Leisner-Ruppin |
Dozent/innen: Prof. Dr. Iris Leisner-Ruppin
[letzte Änderung 26.08.2019]
|
Lernziele:
BSP-16.1 Seminar: Didaktik der PdK
Durch die erfolgreiche Beendigung des Moduls können die Studierenden
- Einblick in Diskurse zu Beobachtung und Dokumentation, deren Verfahren und Evaluationen gewinnen.
- professionstheoretische Diskurse zu Erziehung und Bildung in Beziehung zu Curricula setzen.
- didaktische Theorien wiedergeben und diese in Bezug zur Pädagogik der Kindheit setzen.
- eine eigene Position zu Diskursen und Vertretern der Frühpädagogik (Bildung, Selbstbildung und Instruktion), der Schule und der Erwachsenenbildung ableiten.
Die Lehrenden sollen in der Lage sein
- didaktische Prinzipien und Methoden anzuwenden, um Bildungsprozesse von Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen zu begleiten und zu fördern
- altersspezifische differenzierte Formen des Arrangements und Settings zu gestalten.
- Bedarfe und Interessen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu erkennen und darauf aufbauend Lernarrangements zu entwickeln.
BSP-16.2 Seminar: Ausgewählte Handlungsmethoden
Die Studierenden sollen in der Lage sein
- ausgewählte Handlungsmethoden Sozialer Arbeit oder PdK einzuordnen und anzuwenden.
[letzte Änderung 26.08.2019]
|
Inhalt:
BSP-16.1 Seminar: Didaktik der PdK
Im Rahmen des Seminars wird die in der Entwicklung begriffene Didaktik der Elementarpädagogik in Bezug zur Allgemeinen Didaktik gesetzt. Bildungsprogramme und domänenspezifische Kompetenzen werden vor der Folie von Lernen und Bildung analysiert. Diskurse zur Bildung, (Selbst)Bildung und Instruktion werden unter Berücksichtigung der Entwicklung der Frühpädagogik in Beziehung zur Disziplin und Profession diskutiert. Im Rahmen des Seminars erfährt die Berücksichtigung von Heterogenität für die Gestaltung des Gruppen-und Einzelsettings, der didaktischen und methodischen Planung, Durchführung und Evaluation besondere Bedeutung. Neben der Didaktik der Elementarpädagogik steht die Allgemeine Didaktik (Schule/ Erwachsenenbildung), insbesondere die Theorie der konstruktivistischen Didaktik im Fokus des Seminars.
BSP-16.2 Seminar: Ausgewählte Handlungsmethoden
Im Seminar werden ausgewählte Handlungsmethoden Sozialer Arbeit oder PdK vorgestellt und erprobt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-16.2-1 Schulentwicklung Sandra Hahn
Schule stellt einen zentralen Bestandteil der individuellen Biographie eines Menschen dar. Hinzu kommt, dass die Zahl der Kinder, die in Deutschland einen Hort, eine Ganztagsschule oder eine andere Form der schulischen Betreuung besuchen, steigt. Insbesondere durch diese längere und häufigere Teilnahme an ganztägiger Bildung und Betreuung zählen diese Institutionen zur täglichen Lebenswelt der SchülerInnen und sind somit bedeutend für ihre Entwicklung und Bildung (vgl. Appel/Plehn 2021, S. 1). Hierbei stellt sich die Frage, wie Schule verstanden, gelebt und gestaltet wird. Stellt diese ein Ort des Lernens und der persönlichen Entwicklung dar, ein Ort des Wissenstransfers, als Bewahranstalt, als Schonraum, als Lebens- und Erfahrungsraum, als Sozialisationsinstanz oder als Selektionsinstrument, etc. (vgl. Blömeke et al 2007, S. 11). Hierbei müssen systemische Rahmenbedingungen nicht fraglos akzeptiert werden, sondern sollen als das betrachtet werden was sie sind: eine pädagogische Gestaltungsaufgabe (vgl. ebd. S. 13). Vor diesem Hintergrund hat sich auch die Aufgabe der Schulsozialarbeit weiterentwickelt. Inhaltlich bezieht sich diese nicht nur auf einzelne Problemkonstellationen, sondern richtet ihr Handeln an alle SchülerInnen einer Schule, sowie auch an die Lehrkräfte und Erziehungsberechtigte im Sinne einer Bildungspartnerschaft.
Hier setzt diese Lehrveranstaltung an, sodass neben der Vorstellung von freiwilliger, gebundener oder teiloffener Ganztag, die Vorstellung von Schulkonzepten, das Aufzeigen von Risiken im Schulalltag, auch Themen wie Raum- oder auch Schulhofgestaltung diskutiert werden. Schließlich kennt „Bildung keine Grenzen. Sie wird nicht mehr nur in den Klassenräumen vermittelt, sondern ist vernetzt im gesamten räumlichen Angebot einer Schule erleb- und erfahrbar, also auch den Außenflächen“ (Stadelmann 2023). Denn mit dem „Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung von Grundschulkindern ab 2026 wird die „Institutionalisierung von Kindheit“ (Walther et al 2021, S. 12) weiter voranschreiten. Der Ganztag wird zum ganztägigen Lebensort der Schulkinder, aber auch Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräfte verbringen immer mehr Zeit auf dem Schulgelände – in der Schule und auch draußen auf dem Schulhof“ (ebd.). Somit wird deutlich, dass Räume, deren Gestaltung und ihre Ausstattung entscheidend dazu beitragen, ob SchülerInnen sich wohlfühlen, ihren Ideen und Interessen nachgehen und sich bilden können. Hierzu müssen passende Lehrkonzepte gestaltet werden, in dem LehrerInnen und (Schul-)SozialarbeiterInnen gemeinsam die Bedürfnisse der jeweiligen Klasse beachten.
Um den Theorie-Praxis-Transfer, welcher in hiesiger Veranstaltung zentral ist, nicht nur innerhalb der Hochschule zu verdeutlichen, ist die Durchführung eines ‚Tag des Wissens‘ im schulischen Kontext (Primarstufe, 2. Klasse) avisiert. Die Mitarbeit wird mit der Teilnahme an der Lehrveranstaltung vorausgesetzt.
Aufbau
Die geplante Veranstaltung besteht aus der Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen des Bildungscampus Saarland und der htw saar. Exkursionen sind ebenfalls geplant wie auch die konkrete Umsetzung von Projekten im schulischen Kontext (hierbei ist eine Orientierung an der vorgegeben Seminarzeit geplant, kann aber bei außerhochschulischen Aktionen nicht gewährleistet werden).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-16.2-2 Handlungsmethoden der Sexualpädagogik Moritz Czarny
Die Sexualpädagogik hat theoretisch – als Aspektdisziplin der Pädagogik – und praktisch – in Form institutionalisierter Bildungs- und Hilfeangebote – seit den Siebzigerjahren Eingang in sozialpädagogische Handlungsfelder gefunden (vgl. Schmidt/Sielert/Henningsen 2017). Die Thematisierung von (leiblicher) Intimität in pro-fessionellen sozialen Beziehungen vollzieht sich hierbei in einem Spannungsfeld einer tabuisierenden und repressiven ‚Gefahrenabwehrpädagogik‘ (Sielert), „der naive[n] Vor-stellung, dass eine gründliche Körperaufklärung, der „gesunde Menschenverstand“ und die „richtige Moral“ ausreichten, um Kinder und Jugendliche und Erwachsene in ihrer sexuellen Entwicklung zu begleiten“ (ebd. 2017, S. 1371; Anm. M.C.) sowie den Kämpfen um Deutungshoheiten zwischen konservativen und emanzipatorischen Idealen.
Ausgehend von der anthropologischen Tatsache eines ‚homo sexualis‘, kann folglich die These aufgestellt werden, dass die Bearbeitung geschlechtlich-leiblicher Fragestellungen in Bildungs- und Hilfeprozessen (latent) unvermeidbar ist und somit einer professionellen Reflexion – die spezialisierten Praxisangebote übergreifend – bedarf (vgl. Klepacki/Zirfas 2014; Eggert-Schmid Noerr/ Heilmann/Weißert 2017). Dementsprechend werden wir uns in dem Seminar den Phänomenen Sexualität, Erotik und Liebe grundlagentheoretisch widmen (Freud, Foucault, Fromm), die diesbezüglichen Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in der späten Moderne diskutieren, die aktuelle Vorfälle sexualisierter Gewalt im Namen des ‚pädagogischen Eros‘ thematisieren, um im An-schluss schwerpunktmäßig die Ansätze der konkreten Handlungspraxen zu analysieren. Dies wird in Bezug zu Fallbeispielen aus den Arbeitsfeldern Kindergarten, Schule, Medi-enpädagogik, Heimerziehung und Behindertenhilfe geschehen. Bzgl. Familien-, Sexual- und Schwangerschaftsberatung ist ein Vortrag durch Praxisvertreter*innen geplant. Ne-ben dem Selbststudium wird dies methodisch durch gemeinsame Lektüre, Diskussions-runden, Referate sowie durch Analyse und Erprobung didaktischer Materialien stattfin-den.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-16.2-3 Teamentwicklung Agnes Jasiok
„Das Leben in Gruppen gehört zu unserer menschlichen Existenz so selbstverständlich und unausweichlich wie Geburt und Tod. Wir brauchen andere Menschen, um uns sicher zu fühlen, um produktiv arbeiten zu können (…). Und so hängt unser Wohlbefinden auf dieser Welt nicht zuletzt davon ab, ob und wie es uns gelingt, in den Gruppenkonstellati-onen, in die wir eingebunden sind, ein Zuhause zu finden.“ (Stahl 2012, S. 21). In der Teamentwicklung geht es insb. um den Aufbau konstruktiver Kooperation und eines kol-legialen Arbeitsklimas, das von Vertrauen, gegenseitiger Unterstützung und wechselsei-tiger Wertschätzung geprägt ist.
Die Zusammenarbeit im Team ist maßgeblich davon abhängig, wie wir kommunizieren, wie wir uns nonverbal, absichtsvoll oder unabsichtlich ausdrücken. Auf Grundlage sozial-psychologischer und kommunikationstheoretischer Modelle erproben und reflektieren wir, ausgehend von Ihren Erfahrungen, kreative und ressourcenorientierte Team-Methoden und Kommunikationstechniken, die die konstruktive Zusammenarbeit in Teams unterstützen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-16.2-4 Handlungsmethoden der Erinnerungspädagogik Simone Odierna
Teilnahmevoraussetzung: Interesse am Thema
Notwendig für die Anrechnung des Moduls: kontinuierliche Mitarbeit und Teilnahme an den Exkursionen
. Individuelle Reflexion / „Forschung“ zu Krieg und Frieden, Flucht und Vertreibung
. Digitaler Besuch von Erinnerungsorten, analoge Besuche der Gedenkstätte Neue Bremm und des Memorials in Verdun,
. Reflexion der Erfahrungen
. Evaluation der Erinnerungsortbesuche
. Theoriearbeit (Themen wählbar nach persönlichem Interesse)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[letzte Änderung 26.03.2025]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Literaturstudium
Seminaristische Übungen (Didaktische Planungen)
Referate
Erprobung ausgewählter Methoden, z.B. durch Plan- oder Rollenspiele
[letzte Änderung 26.08.2019]
|
Literatur:
Arnold, Rolf (2008): Die emotionale Konstruktion der Wirklichkeit. Beiträge zu einer emotionspädagogischen Erwachsenenbildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Jank, Werner/ Meyer, Hilpert (2002): Didaktische Modelle. Berlin: Cornelsen.
Kasüschke, Dagmar (Hrsg.) (2010). Didaktik in der Pädagogik der frühen Kindheit. Kronach: Carl Link.
Kron, Friedrich. W./ Jürgens, Eiko/ Standop, Jutta (2014). Grundwissen Didaktik. (6., überarbeitetete Auflage, München: Ernst Reinhardt.
Kucharz, D. (u. a.) (2012): Elementarbildung- Bachelor/Master. Weinheim, Basel: Beltz.
Neuß, Norbert (Hrsg.)(2013): Grundwissen Didaktik für Krippe und Kindergarten. Berlin: Cornelsen.
Siebert, Horst (2012): Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung. Didaktik aus konstruktivistischer Sicht. 7.überarbeitete Auflage, Augsburg: Ziel
Viernickel, Susanne/Völkel, Petra (2009): Beobachten und dokumentieren im pädagogischen Alltag. Freiburg im Breisgau: Herder.
[letzte Änderung 26.08.2019]
|