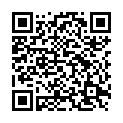|
|
| Modulbezeichnung (engl.):
European Mobility Systems |
|
| Code: MARPF-554 |
|
|
4V (4 Semesterwochenstunden) |
|
6 |
| Studiensemester: laut Wahlpflichtliste |
| Pflichtfach: nein |
Arbeitssprache:
Deutsch/English |
Prüfungsart:
mündliche Prüfung
[letzte Änderung 24.01.2023]
|
MARPF-554 (P420-0544) Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen, Master, ASPO 01.10.2017
, Wahlpflichtfach
|
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 135 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
|
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Steffen H. Hütter |
Dozent/innen:
Prof. Dr. Maximilian Altmeyer
Prof. Dr. Thomas Bousonville
Prof. Dr.-Ing. Thorsten Cypra
Prof. Dr. Steffen H. Hütter
Prof. Dr. Horst Wieker
Yvonne Ewen, M.Sc.
Jens Staub, M.Sc.
[letzte Änderung 07.10.2025]
|
Lernziele:
Die Studierenden sind in der Lage,
- Ideen und Lösungsstrategien für aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Mobilität zu entwickeln
- in einem interdisziplinären Team zu kommunizieren, zu kollaborieren und Arbeitsprozesse als Team zu planen, durchzuführen, und abzuschließen
- komplexe Problemstellungen zu verstehen und zu analysieren
- Konzepte und Strategien neuer digitaler Modelle zur Optimierung des Mobilitätsverhaltens durch die digitale Vernetzung und Nutzung neuer Informationstechnologien zu entwickeln,
- Potentiale und Grenzen digitaler Technologien und Medien einschätzen zu können
- ein komplexes System (ökonomisch, technologisch, ...) zu verstehen und die disziplinäre Relevanz der Subsysteme zu bewerten
• Zahlen, Daten und Fakten zum Stand und zur Entwicklung urbaner und suburbaner Mobilitätssysteme (öffentlich und individual) sammeln und im europäischen Kontext auszuwerten,
• sich einen Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Mobilitätssystemen und dem Mobilitätsverhalten der 10 größten Metropolregionen der EU-27 zu verschaffen und im Sinne der Klimawende („Green Deal der EU“) Optimierungspotentiale aufzudecken.
[letzte Änderung 07.10.2025]
|
Inhalt:
- Interdisziplinäre Betrachtung einer aktuellen Problemstellung der Mobilität der Zukunft
- Blockveranstaltung in vier Präsenzterminen
- Selbstorganisierte Projektarbeit
[letzte Änderung 07.10.2025]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 135 Stunden zur Verfügung.
[letzte Änderung 07.10.2025]
|
Sonstige Informationen:
BMA316 Bauingenieurwesen, Master, ASPO 01.04.2022 , Wahlpflichtfach
KIM-EMS Kommunikationsinformatik, Master, ASPO 01.10.2017 , Wahlpflichtfach
PIM-EMS Praktische Informatik, Master, ASPO 01.10.2017 , Wahlpflichtfach
MARPF-553 Rechnungs-, Prüfungs- und Finanzwesen, Master, SO 01.04.2025 , Wahlpflichtfach
MASCM-DB-553 (P420-0581) Supply Chain Management und Digital Business, Master, SO 01.04.2025 , Wahlpflichtfach
[letzte Änderung 07.10.2025]
|
Literatur:
• Ahrens, G.-A. et al. (2013), Potenziale des Radverkehrs für den Klimaschutz, TU Dresden im Auftrag des Umweltbundesamtes.
• Behrend, M. / Meisel, F. (2017), Sharing Economy im Kontext urbaner Mobilität, in: Proff, H. / Fojcik, T. M. (Hrsg.), Innovative Produkte und Dienstleistungen in der Mobilität - Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte, Wiesbaden: Springer, S. 335-346.
• BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2019), Deutsches Mobilitätspanel (MOP), Längsschnittstudie zum Mobilitätsverhalten der Bevölkerung, Jahresbericht 2017-2018.
• BMVI - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (2018), Mobilität in Deutschland (MID), Studie mit Fokus auf die tief differenzierten Auswertemöglichkeiten demografischer, sozioökonomischer und regionaler Mobilitätsmuster.
• Chlond, B. (2013), Multimodalität und Intermodalität, in: Beckmann, K. / Klein-Hitpaß, A. (Hrsg.). Nicht weniger unterwegs, sondern intelligenter? Neue Mobilitätskonzepte. Deutsches Institut für Urbanistik (DifU), Edition Band 11, Berlin, S. 271-293.
• Deffner, J. / Hefter, T. / Götz, K. (2013), Multioptionalität auf dem Vormarsch? Veränderte Mobilitätswünsche und technische Innovationen als neue Potenziale für einen multimodalen Öffentlichen Verkehr, in: Schwedes, O. (Hrsg.), Öffentliche Mobilität - Perspektiven für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung, Wiesbaden: Springer, S. 201-227.
• Eryilmaz, E. et al. (2014), Collaborative Management of Intermodal Mobility, FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Verkehrswesen.
• Gebhardt, L. et al. (2016), Intermodal Urban Mobility: Users, Uses, and Use Cases, in: Transportation Research Procedia, Vol. 14, S. 1183-1192.
• Goletz, M. / Heinrichs, D. / Feige, I. (2016), Mobility Trends in cutting-edge cities, ifmo - Institut für Mobilitätsforschung, München.
• Henkel, S. et al. (2015), Mobilität aus Kundensicht - Wie Kunden ihren Mobilitätsbedarf decken und über das Mobilitätsangebot denken, Wiesbaden: Springer.
• ifmo - Institut für Mobilitätsforschung (Hrsg.) (2011), Mobilität junger Menschen im Wandel - multimodaler und weiblicher, München.
• Jarass, J. / Oostendrop, R. (2017), Intermodal, urban, mobil – Charakterisierung intermodaler Wege und Nutzer am Beispiel Berlin, in: Raumforschung und Raumordnung 75, S. 355-369.
• Kagerbauer, M. et al. (2015), Intermodale Mobilität - Elektromobile Fahrzeugkonzepte als Zubringer zum Öffentlichen Verkehr, in: Proff, H. (Hrsg.), Entscheidungen beim Übergang in die Elektromobilität - Technische und betriebswirtschaftliche Aspekte, Wiesbaden: Springer, S. 567-583.
• Kindl, A. et al. (2018), Smart Station - Die Haltestelle als Einstieg in die multimodale Mobilität, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur unter FE-Nr. 70.918/2016, Berlin.
• Kuhnimhof, T. et al. (2019) - Veränderungen im Mobilitätsverhalten zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität, Abschlussbericht Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) im Auftrag des Umweltbundesamtes (Forschungskennzahl 3716581050, UBA-FB 002834), Texte 101/2019.
• Nobis, C. (2013), Multimodale Vielfalt. Quantitative Analyse multimodalen Verkehrshandelns, Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, Berlin.
• Schönau, M. (2016), GPS-basierte Studien zur Analyse der nachhaltigen urbanen Individualmobilität, Dissertation, Universität Ulm, Ulm.
• Wolter, S. (2012), Smart Mobility – Intelligente Vernetzung der Verkehrsangebote in Großstädten, veröffentlicht in: Zukünftige Entwicklungen in der Mobilität, S. 527-548, Springer Fachmedien Wiesbaden.
• Zumkeller, D. et al. (2005), Die intermodale Vernetzung von Personenverkehrsmitteln unter Berücksichtigung der Nutzenbedürfnisse (INVERMO), Schlussbericht der KIT, Karlsruhe.
[letzte Änderung 24.01.2023]
|