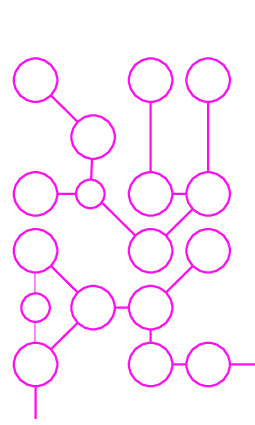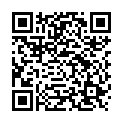|
|
| Modulbezeichnung (engl.):
Study Project |
|
| Code: BSP-21 |
|
|
2U+6S (8 Semesterwochenstunden, kumuliert) |
|
16 |
| Studiensemester: 6 |
| Dauer: 2 Semester |
| Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
BSP-21.1/.2/.3/.4: Projektbericht mit Verteidigung (PB) (bn) 50% + Mündliche Prüfung (MP) (bn) 50%
[letzte Änderung 15.01.2026]
|
BSP-21 (P322-0102) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2017
, 6. Semester, Pflichtfach
BSP-21 (P322-0102) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2019
, 6. Semester, Pflichtfach
|
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 120 Veranstaltungsstunden (= 90 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 16 Creditpoints 480 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 390 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
BSP-13 Forschungsmethodische Grundlagen und Evaluation II: Methoden der Datenauswertung
BSP-9 Forschungsmethodische Grundlagen und Evaluation 1: Methoden der Datenerhebung
[letzte Änderung 15.01.2026]
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
|
Modulverantwortung:
Professor/innen des Studiengangs |
Dozent/innen:
Dr. Sebastian Rahn
Prof. Dr. Mario Schreiner
Prof. Dr. Christian Schröder
Dr. Laura Venitz
Professor/innen des Studiengangs
[letzte Änderung 15.01.2026]
|
Lernziele:
Durch die erfolgreiche Beendigung des Moduls können die Studierenden
• die elementaren erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden der Datenerhebung und -Auswertung anwenden,
• frage- und problembezogen denken,
- exemplarisch handlungsfeldbezogene Forschungsfragen operationalisieren.
• Feldexplorationen organisieren und kleinere empirische Untersuchungen praktisch durchführen, auswerten und deren Verwendung kritisch reflektieren,
- einen Forschungsbericht anfertigen,
- die Forschungserkenntnisse konzeptionell auf kleinere Projekte im Rahmen Sozialer Arbeit übertragen,
- rechtliche Fragestellungen mit ihrem eigenen Forschungsfeld in Bezug setzen.
[letzte Änderung 19.09.2017]
|
Inhalt:
BSP-21.1-1/BSP-21.2-1 Laura Venitz
BSP-21.1 Seminar zum Studienprojekt I
Im Seminar fertigen die Studierenden unter Anleitung der Dozierenden eine qualitative oder quantitative Forschungsarbeit zum Thema „Nutzung von Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren in Kindertageseinrichtungen“ an. Inhaltlich soll das Seminar darauf vorbereiten, im Rahmen des Studienprojektes eine schriftliche Befragung oder ein Interview mit pädagogischen Fachkräften zu führen. Die pädagogischen Fachkräfte sollen in diesem Rahmen berichten, welche Verfahren der Beobachtung und Dokumentation genutzt werden, welche Chancen und Herausforderungen damit einhergehen und inwieweit sie die Verfahren nutzen, um eine individuelle Förderung der Kinder zu ermöglichen, die eine Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Hilfestellen einschließt. Theoretische Inhalte wie unterschiedliche Verfahren der Beobachtung und Dokumentation in Kindertageseinrichtungen, Beobachtungsziele und Anforderungen an pädagogische Fachkräfte sowie forschungspraktische Themen zum gewählten Studienprojekt werden erörtert.
BSP-21.2 Methodenwerkstatt: Übung
Die Methodenwerkstatt bietet einen Überblick zur Methodenentwicklung in der qualitativen und quantitativen Sozialforschung. Sowohl Verfahren der Datenerhebung als auch der
Datenauswertung werden im Lichte unterschiedlicher methodologischer Konzepte vorgestellt. Die Studierenden erhalten Gelegenheit, das Forschungsmaterial aus ihren jeweiligen Projekten vorzustellen und zu diskutieren. Bezüge zu den spezifischen Projektfragestellungen, die sich durch das eigene Forschungsvorhaben ergeben, können entwickelt werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-21.1-2/BSP-21.2-2 Tamara Marksteiner
"Kinder- und Jugendhilfeplanung"
Die Kinder- und Jugendhilfe steht vor wachsenden Herausforderungen: Der demografische Wandel, veränderte Familienstrukturen und steigende soziale Ungleichheiten beeinflussen die Bedarfe und Angebote der Jugendhilfe erheblich. Kommunale und überregionale Planungsprozesse müssen sich diesen Entwicklungen anpassen, um passgenaue Hilfsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien bereitzustellen. Doch wie können Bedarfe verlässlich ermittelt werden? Welche Rolle spielen Daten und sozialräumliche Analysen in der Jugendhilfeplanung? Und wie lassen sich auf dieser Grundlage tragfähige Konzepte für die Zukunft entwickeln?
Das Seminar führt in die Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfeplanung ein und verknüpft theoretisches Wissen mit praxisnaher Datenanalyse. Die Studierenden setzen sich mit den rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen auseinander, darunter das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) und die Aufgaben kommunaler Jugendhilfeplanung. Dabei stehen insbesondere datengestützte Bedarfsplanungen im Fokus. Anhand aktueller Daten zur Kinder- und Jugendhilfe im Saarland (z.B. Regionaldatenbank, Statistisches Landesamt) lernen die Teilnehmenden, wie Indikatoren für die Planung genutzt werden, welche regionalen Unterschiede bestehen und wie statistische Auswertungen als Entscheidungsgrundlage für Fachkräfte und Politik dienen können.
Ein zentraler Bestandteil des Seminars ist die eigenständige Aufbereitung und Interpretation realer Daten der Kinder- und Jugendhilfe im Saarland. Die Studierenden analysieren Kennzahlen, visualisieren Trends und entwickeln darauf basierend erste Einschätzungen zu lokalen Herausforderungen und Handlungsbedarfen. Ihre Ergebnisse werden abschließend in einem Fachgespräch diskutiert, um verschiedene Perspektiven der Jugendhilfeplanung zu reflektieren.
Abgerundet wird das Seminar durch einen Austausch mit einem Landesjugendamt (ggf. Exkursion), bei dem die Studierenden einen direkten Einblick in die Praxis der Jugendhilfeplanung erhalten können. Im Austausch mit Expert:innen erfahren sie, wie datenbasierte Entscheidungen getroffen werden, welche Herausforderungen in der Umsetzung bestehen und welche innovativen Ansätze aktuell diskutiert werden. Dadurch erhalten sie nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch wertvolle Einblicke in die Steuerung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in der Region.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-21.1-3/BSP-21.2-3 Mario Schreiner
„Kontext Behinderung und Behindertenhilfe"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-21.1-4/BSP-21.2-4 Christian Schröder / Rosanna Linardi-Jung
„Soziale Arbeit und quartiersbezogene Armut"
Im Studienprojekt werden wir in drei Perspektivquartieren, Burbach sowie der Innenstadt von Neunkirchen und von Völklingen, die Potentiale der Methode Design Thinking für Lösungsansatz quartiersbezogener Armut erproben. Studierende, Lehrende, Vertreter*innen der städtischen Ämter sowie Praxispartner*innen arbeiteten eng zusammen, um gemeinsam Bedarfe von Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Lebensphasen zu identifizieren und Angebotsideen für die Soziale Arbeit zu entwickeln. Das Studienprojekt läuft im Rahmen eines laufenden Projekts, dass gemeinsam mit dem Sozialministerium aktuell durchgeführt wird.
Im Seminar werden Sie sich mit Fragestellungen zur quartiersbezogenen Armut auseinandersetzen und versuchen, diese sozialräumlich aus der Perspektive der Sozialen Arbeit zu beleuchten. Dabei wird Armut nicht nur objektiv anhand statistischer Fakten definiert, sondern auch durch qualitative Erhebungen ergänzt, um sozialpolitische Maßnahmen zu entwickeln. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Scham, sozialer Ausgrenzung sowie der Rolle der Mitleidsökonomie bei der Bewältigung von Armut. Quartiere werden als potenzielle Lösungsräume betrachtet, wobei kritisch hinterfragt wird, ob diese Fokussierung nicht zu weiterer Stigmatisierung führt und ob Lösungen möglicherweise außerhalb der Quartiere gefunden werden müssen.
Eine Auswahl der im Studienprojekt entwickelten praxisbezogenen Angebote werden im Projektkontext weiterentwickelt und auch zur Anwendung
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-21.1-5/BSP-21.2-5 Sebastian Rahn/ Lars Bieringer
„Rahmenbedingungen und professionelles Handeln in der Schulsozialarbeit"
Schulsozialarbeit als „bislang intensivste Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule“ (Bolay/Iser 2016, S. 142) hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem weitverbreiteten sozialpädagogischen Angebot am Ort Schule entwickelt (Zipperle/Rahn 2020). Und auch auf rechtlicher Ebene verweist der 2021 in Kraft getretene § 13a SGB VIII auf die Etablierung von Schulsozialarbeit als eigenständiges schulbezogenes Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit. Trotz bzw. parallel zu dieser Ausweitung und rechtlichen Verankerung wird jedoch weiterhin um das professionelle Berufsbild und um fachliche Mindeststandards der Schulsozialarbeit gerungen (Zipperle et al. 2018). So ist die Frage danach, unter welchen Rahmenbedingungen Schulsozialarbeit als sozialpädagogisches Angebot am Ort Schule tätig wird bzw. werden sollte, bisher nicht hinreichend geklärt (Speck 2022, Rahn/Hettler 2023).
Vor diesem Hintergrund erhalten die Studierenden im Studienprojekt eine grundlegende Einführung in das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit (z.B. rechtliche Grundlagen, methodisches Handeln) und recherchieren selbstständig aktuelle empirische Erkenntnisse zu diesem Arbeitsfeld (Zipperle/Baur 2023). Zusätzlich werden Praxisbezüge über interaktive Formate hergestellt (z.B. Exkursionen in die Praxis, Besuche von Expert*innen). Der Frage nach dem Zusammenhang von Rahmenbedingungen und professionellem Handeln in der Schulsozialarbeit gehen die Studierenden dann in ihren eigenen Projekten auf unterschiedlichen Ebenen (z.B. Trägerstrukturen, schulische Rahmenbedingungen) und hinsichtlich unterschiedlicher Facetten (z.B. Angebotsschwerpunkte, Kooperationen) nach.
Das Studienprojekt ist dabei eingebettet in das an der htw saar angesiedelte Forschungsprojekt SibV („Schulsozialarbeit im bundesweiten Vergleich“), das sich ebenfalls mit den oben genannten Themen beschäftigt und dazu eine bundesweite Befragung von Fachkräften der Schulsozialarbeit durchführt. Die Studierenden nutzen für ihre Analysen den aus dem Forschungsprojekt SibV stammenden Datensatz und können als Co-Forschende eigene Fragestellungen bearbeiten. Die genaue Forschungsfrage ist dabei im Rahmen des Forschungsprojekts SibV frei wählbar. Im Fokus stehen dabei statistische Analysen (z.B. Korrelationen, Regressionen) zu den Zusammenhängen zwischen Rahmenbedingungen und Praxis. Dementsprechend liegt der Schwerpunkt des begleitenden Methodenseminars auf der Auseinandersetzung mit quantitativen Analyseverfahren und der Auswertungssoftware SPSS.
Im Rahmen des Studienprojekts ist eine Kooperation mit der TH Nürnberg geplant. Voraussichtlich wird es eine Exkursion geben, in deren Rahmen die Studierenden ihr Studienprojekt anderen Studierenden und Forscher*innen präsentieren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-21.3 Seminar zum Studienprojekt II
Im Anschluss an das Seminar BSP-21.1 führen die Studierenden unter Anleitung der Dozierenden eine qualitative oder quantitative Forschungsarbeit zu einem aktuellen Thema der Sozialen Arbeit oder der Pädagogik der Kindheit durch. Die Ergebnisse münden in ein studentisches Projekt, das unter Anleitung der Dozierenden konzeptualisiert und durchgeführt wird. Die Ergebnisse werden im Studienprojektbericht dokumentiert. Die Dozierenden begleiten die Anfertigung des Studienprojektberichts und bereiten die Studierenden auf die Verteidigung ihres Studienprojektberichts vor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BSP-21.4 Ausgewählte rechtliche Fragestellungen
Im Seminar werden rechtliche Fragestellungen, die mit dem Thema des jeweiligen Studienprojekts in Bezug gesetzt werden, erörtert. Darüber hinaus werden die Studierenden durch Übungen auf die mündliche Verteidigung ihres Studienprojektberichts vorbereitet.
[letzte Änderung 11.03.2025]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
- Vorlesung
- Selbststudium: Lesen und Bearbeiten von Fachliteratur über den Modulbereich
- Kritische moderierte Diskussion in Kleingruppen und im Plenum
- Mündliche Auseinandersetzung mit Themenbereichen des Moduls (Seminargespräch)
- Schriftliche Auseinandersetzung mit Themenbereichen des Moduls (Verfassen kleinerer Schreibaufträge)
- Fallstudien
- Projektarbeit
[letzte Änderung 04.11.2017]
|
Literatur:
Literatur wird dem jeweiligen Thema entsprechend von den Dozierenden im Seminar angegeben.
[letzte Änderung 19.09.2017]
|