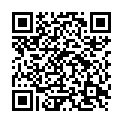|
|
|
| Code: DBING-250 |
|
|
56UV+48UU (104 Unterrichtseinheiten) |
|
8 |
| Studienjahr: 2 |
| Pflichtfach: ja |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
2 Teilprüfungen:
• Bauphysik: Klausur (90 min)
• Nachhaltige Gebäudekonzepte: Hausarbeit
o Das Thema ist eine Problemstellung mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Gebäudekonzepten, die eigenständig zu bearbeiten ist.
o Es wird am ersten Arbeitstag der 3. Woche des Blockes 3A verteilt, umfasst 75 Stunden Arbeitsaufwand und ist in einem
Zeitraum von 60 Werktagen (Mo-Fr außer gesetzlichen Feiertagen) ab Ausgabe des Themas in den Übungen (28 UE/ 21 h) und
im Rahmen des Selbststudiums (57 h) zu bearbeiten.
Modulnote:
50 der Punkte aus der Klausur
50 % der Punkte aus der Hausarbeit
[letzte Änderung 10.09.2025]
|
DBING-250 (P750-0017, P750-0018) Integrierte nachhaltige Gebäudetechnik, Bachelor, SO 01.10.2024
, 2. Studienjahr, Pflichtfach
|
|
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst 104 Unterrichtseinheiten (= 78 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 8 Creditpoints 240 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 162 Stunden zur Verfügung.
|
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
DBING-130 Naturwissenschaftliche Grundlagen
DBING-160 Grundlagen der Thermodynamik
DBING-180 Baukonstruktion
[letzte Änderung 12.11.2025]
|
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
DBING-330 Heiz-, Kälte- und Klimatechnik
DBING-350 Energiesysteme und Grüne Technologien
[letzte Änderung 11.11.2025]
|
Modulverantwortung:
Prof. Dr.-Ing. Jan Christoph Gaukler |
Dozent/innen:
Lehrbeauftragte
[letzte Änderung 12.11.2025]
|
Lernziele:
Bauphysik
Die Studierenden können bauphysikalische Vorgänge verstehen und erklären. Sie können Wärme- und Feuchtetransportvorgänge berechnen und vereinfachte Berechnungen zu Energiebedarfen und Heizlastberechnungen durchführen. Sie verstehen die Grundlagen der Akustik und des Schallschutzes in Gebäuden und können Brandschutzmaßnahmen nennen.
Nachhaltige Gebäudekonzepte
Die Studierenden verstehen die fachübergreifenden Zusammenhänge von architektonischer Konzeption, Baukonstruktion und nachhaltiger Gebäudetechnik und können notwendige, innovative bzw. architektonische Veränderungen unter Berücksichtigung von Ökologie und Nachhaltigkeit analysieren und in die Planung von Neubauten oder von Sanierungen von Bestandsbauten ein-fließen lassen. Sie sind in der Lage, Querverbindungen herzustellen, Abhängigkeiten zu erkennen, und können zwischen den verschiedenen in der Planung zu berücksichtigenden Aspekten abwägen. Die Studierenden können entwerferische, konstruktive und gebäudetechnische Aspekte in ihrer Gesamtheit verstehen und ggf. mögliche konzeptionelle Irrwege hinterfragen.
[letzte Änderung 19.08.2025]
|
Inhalt:
Bauphysik
o Wärmeschutz (Sommer / Winter):
- Grundlagen: Feuchte, Temperatur, Wärme, Wärmebedarf, Behaglichkeit, Wär-meübertragung (Vertiefung und Anwendung auf
Gebäude), Wärmebrücken, Gebäudeenergiegesetz
o Feuchteschutz: Wasserdampfdiffusion, Tauwasser, Feuchteschutz im Hochbau
o Schallschutz: Grundlagen der Akustik, Schallschutz im Hochbau
o Brandschutz (Einf.)
Grundlagen der nachhaltigen Gebäudeplanung
o Ganzheitliche Konzeption bei Neu- und Bestandsbauten durch Verknüpfung von architektonischer Konzeption,
Baukonstruktion und nachhaltiger Gebäudetechnik
o Passive Maßnahmen für Neu- und Bestandsbauten
- Best-Practice-Beispiele zu nachhaltigen Gebäudekonzepten
- „Climate-responsive Architecture“: Zonierung – Pufferzonen – Orientierung, Tageslichtnutzung – Verschattung,
Wärmespeicherung, Bauteilaktivierung
- Einflüsse von Außenluft, Feuchte, Sonneneinstrahlung und Windströmung
o Aktive Maßnahmen:
- Aktive Prozesse der Energieumwandlung: Wärmegewinnung und -umwandlung, Energierückgewinnung und -speicherung
- Methoden der Energieverteilung
[letzte Änderung 19.08.2025]
|
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Die in den Vorlesungen vermittelten Inhalte werden an einem kleinen beispielhaften Entwurf in Übungsschritten vertieft.
Vorlesung: Vortrag, Frage- und Impulsunterricht, Unterrichtsgespräch
Übungen: Frage- und Impulsunterricht, Bearbeitung konkreter Problemstellungen
Hausarbeit: Eigenständige Bearbeitung einer konkreten Problemstellung
[letzte Änderung 20.08.2025]
|
Literatur:
• Djouahra, G.: Bauphysik: Skript zur Vorlesung
• Duzia, T./Bogusch, N.: Basiswissen Bauphysik: Grundlagen des Wärme- und Feuchteschutzes, Fraunhofer IRB Verlag
- Hausladen, Gerhard u.a.: ClimaDesign: Lösungen für Gebäude, die mit weniger Technik mehr können, München 2005
- Pfeiffer, Martin u.a.: Nachhaltiges Bauen – wirtschaftliches, umweltverträgliches und nutzungsgerechtes Bauen, München 2024
- Bohne, Dirk: Ökologische Gebäudetechnik – praktische Einführung in die ökologische Gebäudetechnik, Stuttgart 2004
- Herzog, Thomas u.a.: Fassaden Atlas, München 2016
- Krimmling, Jörn: Atlas Gebäudetechnik, Köln 2021
- Pistohl, Wolfram u.a.: Handbuch der Gebäudetechnik - Planungsgrundlagen und Beispiele: Band 1: Allgemeines, Sanitär, Elektro, Gas, Köln 2016
- Pistohl, Wolfram u.a.: Handbuch der Gebäudetechnik - Planungsgrundlagen und Beispiele: Band 2: Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Energiesparen, Köln 2016
[letzte Änderung 12.11.2025]
|